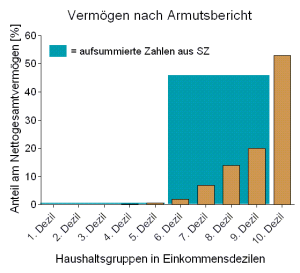Begriffe sauber zu unterscheiden ist eine Grundvoraussetzung für Erkenntnis. Wer Reiz und Erregung durcheinanderbringt, wird kein Physiologe, wer Gerundium und Gerundivum nicht trennt, kein Latinist, und wer Masse und Gewicht verwechselt, kein Physiker. In den klassischen Wissenschaften beiderseits des großen Grabens hatten Gelehrte etliche Jahrhunderte hingebungsvollen Forschens und Definierens zur Verfügung, um die Grundbegriffe ihrer Gebiete zu klären und damit Verständnis überhaupt möglich zu machen.
In anderen Wissenschaften scheint diesbezüglich noch Arbeit zu tun. In den jüngeren, vor allem aber, so vermute ich: in denjenigen Wissenschaften, in denen das Eigeninteresse in die Forschung eingreift und das Wissen nach der Macht schielt.
So kommt es, dass in den Politikwissenschaften „Demokratie“ als synonym mit „parlamentarischer Repräsentanz“ verwendet wird, und in den Wirtschaftswissenschaften „Marktwirtschaft“ und „Kapitalismus“ dasselbe bedeutet. Obgleich doch gerade die letzteren beiden Begriffe sich auf komplett unterschiedliche wirtschaftliche Prozesse beziehen und sich in der Praxis bisweilen sogar diametral zueinander verhalten.
Aber die Wirtschaftswissenschaften haben es unter der Last der Ideologien besonders schwer. Man fragt sich, ob man nicht lieber von Wirtschafts“wissenschaften“ sprechen sollte.
Sonst könnten sie längst unterscheiden zwischen Inflation und Preissteigerung. Das ist eigentlich ganz einfach: Inflation ist – wörtlich – eine Aufblähung der Geldmenge. Preissteigerung ist – wer hätte das gedacht? – ein Anstieg der Preise.
In der Theorie sind diese beiden Vorgänge untrennbar gekoppelt. Mit dem pompösen Namen „Quantitätsgleichung“ adelt die Wirtschafts“wissenschaft“ den trivialen Zusammenhang: Preisniveau = Geldmenge/Gütertransaktionen. (Eigentlich muss man die Geldmenge noch mit der Umlaufgeschwindigkeit multiplizieren, und eigentlich ist das sogar sehr wichtig, aber nicht hier). Man sieht auf den ersten Blick: Solange die Gütertransaktionen konstant sind, steigt das Preisniveau, wenn die Geldmenge steigt, und umgekehrt.
Aber in den Jahren seit der Finanzkrise 2008 hatten wir eine ballonartig sich aufblähende Geldmenge, als die Zentralbanken durch Nullzinsen und Anleihenkäufe alles versucht haben, um Geld auf den Markt zu bringen. Aber die Preise blieben weitgehend stabil. Das war ja gerade das Problem: Die EZB wollte Inflation „machen“ und schaffte es nicht. In diesem Jahr hingegen steigen die Preise plötzlich um 10%, aber von einer Aufblähung der Geldmenge merke ich auf meinem Konto bislang nichts.
Es springt ins Auge: Anders, als die Quantitätsgleichung behauptet, können Preisniveau und Geldmenge voneinander entkoppelt werden. Der mutige Satz auf Wikipedia – „Die Quantitätsgleichung ist definitionsgemäß immer wahr und empirisch nicht falsifizierbar.“ – ist leichtsinnig. Er gilt vielleicht auf einem optimalen Markt in einem optimalen Finanzsystem. Aber nicht hier und jetzt. Inflation und Preissteigerung sind in der Realität zwei zu trennende Begriffe.
Und das ist im wirklichen Leben wichtig. Denn weil die EZB außerstande ist, diese Begriffsunterscheidung vorzunehmen, beantwortet sie eine vermeintliche „Inflation“ durch Zinserhöhungen. Da es aber überhaupt keine Inflation gibt, kann sie diese auf diese Weise auch nicht bekämpfen. Stattdessen hängt sie damit der absaufenden Wirtschaft noch ein paar Bleigewichte an die Füße.